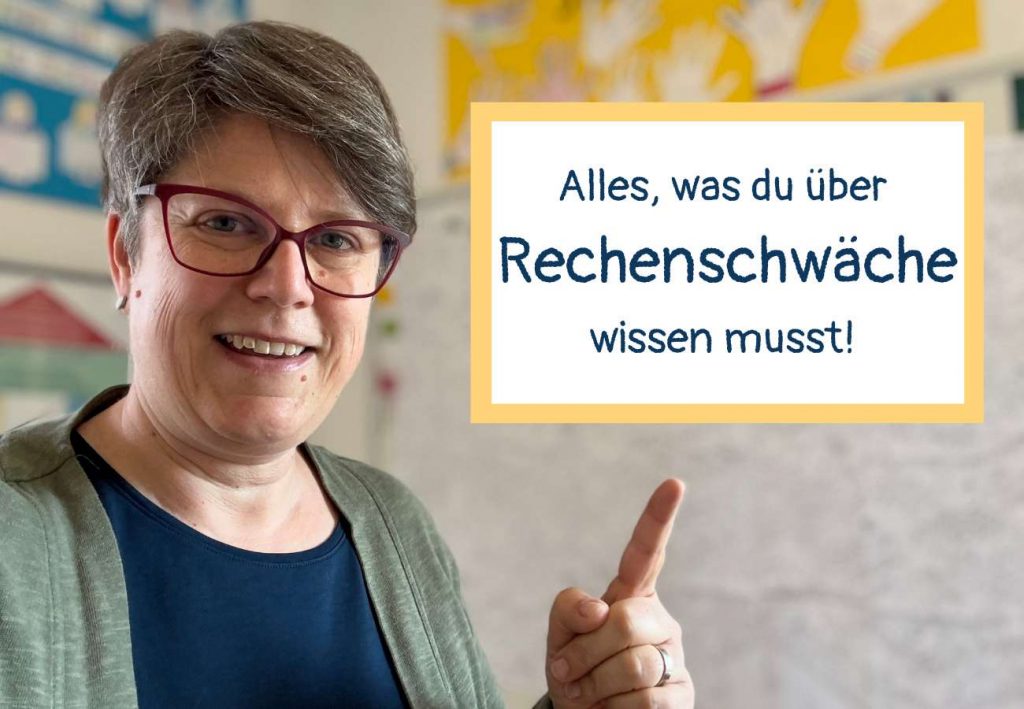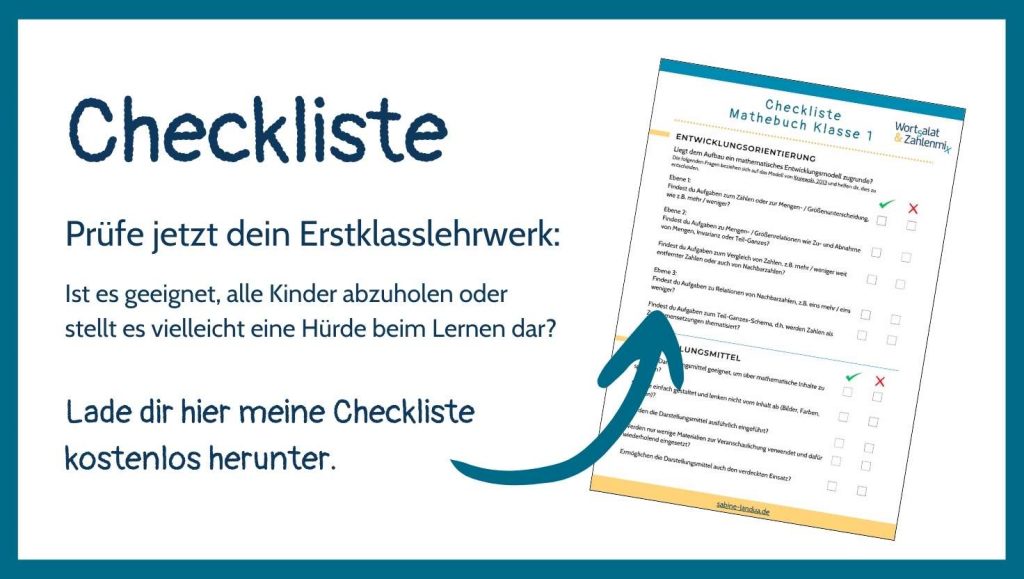„Wie soll ich denn einkaufen gehen? Ich kann doch nicht mit dem Taschenrechner im Supermarkt stehen!“, sagte mir vor kurzem eine Schülerin. Zwar zahlen wir Erwachsene heute meist mit Karte und die Kasse rechnet alles automatisch zusammen – für Kinder ist die Lebenswelt jedoch eine andere, wenn sie mit begrenztem Bargeldvorrat etwas kaufen möchten. Darüber hinaus gehört das Rechnen zu den wichtigsten Grundlagen in ihrem Schulalltag. Viele Jahre müssen sie ohne Hilfsmittel, wie den Taschenrechner, auskommen. Vielen Kindern und Jugendlichen fällt das Rechnen jedoch schwer. Hinter anhaltenden Schwierigkeiten kann eine Rechenschwäche (Dyskalkulie) stecken. In diesem Artikel erfährst du, was Rechenschwäche genau ist, wie man sie erkennt, welche Ursachen dahinterstecken und welche Hilfen es gibt.
Rechenschwäche – das muss du wissen
Rechenschwäche ist keine Frage der Intelligenz, sondern eine spezifische Lernstörung, die mit den richtigen Methoden überwunden werden kann.
Frühe Diagnostik und gezielte Förderung sind entscheidend! Je eher Kinder Unterstützung erhalten, desto besser sind ihre Chancen auf langfristige Erfolge.
Eltern sind wichtige Begleiter, aber keine „Lehrkräfte“. Dein Kind braucht vor allem eine Lerntherapie, in der die wichtigsten Grundlagen aufgearbeitet werden. Mit viel Geduld und Ermutigung gewinnt dein Kind den Glauben an seine eigenen Fähigkeiten zurück.
Lerntherapie ist mehr als Nachhilfe: Sie hilft Kindern, mathematische Grundlagen zu verstehen, Blockaden zu lösen und wieder Freude am Lernen zu finden.
Schule, Therapie und Alltag müssen Hand in Hand gehen – nur so entsteht ein nachhaltiger Erfolg.
Was ist eine Rechenschwäche / Dyskalkulie?
Rechenschwäche, auch Dyskalkulie genannt, ist eine Lernstörung, die sich speziell auf das Erlernen und Anwenden mathematischer Fähigkeiten auswirkt. Betroffene Kinder und Jugendliche haben trotz normaler Intelligenz und ausreichender Beschulung große Schwierigkeiten, grundlegende Rechenfertigkeiten zu erlernen. Es geht dabei nicht einfach um „schlechtes Rechnen“ oder mangelnde Übung, sondern um eine tiefgreifende Störung des Zahlenverständnisses.
Für diese Lernstörung werden häufig sehr unterschiedliche Begriffe verwendet: „Rechenschwäche“, „Rechenstörung“, „Dyskalkulie“, „Rechenschwierigkeiten“, „besondere Schwierigkeiten beim Mathematiklernen“ oder „besondere Schwierigkeiten beim Rechnen“. Eine kurze Zusammenfassung findest du im folgenden Abschnitt. Wenn du mehr lesen möchtest, kannst du auch hier weiterlesen: Rechenschwäche, Rechenstörung, Dyskalkulie – was ist das und wie erkenne ich es?
Begriffe im Überblick: Was steckt dahinter?
Der Begriff besondere Schwierigkeiten beim Rechnen bzw. Mathematiklernen findet überwiegend im schulischen Kontext Verwendung, z. B. in Gutachten oder Förderplänen. Er beschreibt Kinder, die deutlich unter den erwarteten Leistungen liegen, ohne dass eine medizinische Diagnose vorliegen muss.
Im medizinischen und neuropsychologischen Kontext dagegen werden die Begriffe Dyskalkulie oder Rechenstörung verwendet. Hier wird eine Rechenstörung als neurologisch bedingte Entwicklungsstörung eingestuft – ähnlich wie eine Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Die Diagnose erfolgt durch standardisierte Tests und schließt andere Ursachen (z. B. Intelligenzminderung, Seh- oder Hörstörungen) aus.
Rechenschwäche wird als Begriff oft synonym verwendet und beschreibt deutlich unterdurchschnittliche mathematische Leistungen, unabhängig von der Intelligenz des Kindes.
Im Sprachgebrauch trifft man immer wieder auch auf die qualitative Unterscheidung zwischen „Rechenschwäche“ (nicht so schlimm) und „Rechenstörung“ (schwere Störung). Diese Unterscheidung ist wissenschaftlich umstritten. Aktuelle Studien zeigen sogar, dass sich betroffene Kinder in Ursachen und Förderbarkeit kaum unterscheiden – egal, welcher Begriff verwendet wird. (vgl. Küspert 2018)
Wie wird Rechenschwäche definiert?
Laut ICD-11 (der internationalen Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation) liegt eine Rechenstörung vor, wenn ein Kind dauerhafte Schwierigkeiten in zentralen mathematischen Bereichen hat, z. B.:
- Zahlenverständnis (z. B. Mengen erfassen, Zahlen ordnen, zählen)
- Grundrechenarten (z. B. 5 + 3 = ?, 10 – 4 = ?)
- Rechenflüssigkeit (schnelles, automatisiertes Rechnen)
- Mathematisches Denken (z. B. Sachaufgaben lösen)
Dabei müssen die Leistungen deutlich unter dem Niveau liegen, das aufgrund des Entwicklungsalters und der Intelligenz zu erwarten wäre. Gleichzeitig dürfen die Schwierigkeiten in Mathematik nicht auf Defizite im Hören oder Sehen, auf eine neurologische Störung, mangelnde Sprachkenntnisse, fehlende Beschulung oder psychologische Störungen zurückgeführt werden.
Über die Bedeutung der Berücksichtigung der Intelligenz in Bezug auf Lernstörungen herrscht in der Fachwelt Uneinheitlichkeit. Das für die Diagnosestellung laut ICD-11 verwendete „Diskrepanzkriterium“ (also Schwierigkeiten beim Rechnen, bei sonst normaler Intelligenz) wird allerdings nicht mehr überall angewendet – die S3-Leitlinie zur Rechenstörung rät sogar davon ab. Rechenschwierigkeiten sind Rechenschwierigkeiten – unabhängig von der zu einem bestimmten Zeitpunkt gezeigten Intelligenzleistung (was nur eine Momentaufnahme ist).
Wie häufig ist Rechenschwäche?
Studien zeigen, dass 2 bis 8 % aller Kinder von einer Rechenschwäche betroffen sind. Die Zahlen variieren je nachdem, welche Definition zugrunde gelegt wird. Dabei sind Jungen und Mädchen etwa gleich häufig betroffen auch wenn ältere Studien teilweise andere Zahlen nennen. (vgl. S3-Leitlinie, Landerl et al. 2022).
Ohne eine gezielte Förderung bleibt die Rechenschwäche oft bestehen und kann negative Auswirkungen auf den schulischen und später beruflichen, aber auch auf den privaten Bereich haben. Eine Studie von Schulz und Kollegen (2018) zeigte, dass 75 % der betroffenen Kinder auch nach 3 Jahren noch unterdurchschnittliche Rechenleistungen aufwiesen. Sie konnten auch belegen, dass ältere Probanden eine schlechtere Prognose aufwiesen als jüngere Schüler. Dies zeigt, wie wichtig eine möglichst frühzeitige Förderung in diesem Bereich ist.
Rechenschwäche und ihre Begleiterscheinungen
Kinder mit Rechenschwäche sind häufig nicht nur in Mathe gefordert, viele haben zusätzlich weitere Schwierigkeiten zu bewältige. Studien zeigen, dass Aufmerksamkeitsdefizitstörungen (ADHS oder ADS) bei bis zu 40 % der betroffenen Kinder vorkommen. Auch eine Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) tritt oft gemeinsam mit Rechenschwäche auf, in etwa 25 bis 40 % der Fälle. (vgl. Ise & Schulte-Körne, 2013; Landerl et al., 2022)
Doch die Begleiterscheinungen gehen häufig über schulische Leistungen hinaus. Kinder mit Lernschwierigkeiten berichten häufiger von stärkeren psychischen Belastungen als Gleichaltrige ohne Probleme in der Schule. Das zeigt sich zum Beispiel in Depressionen, Ängsten – etwa Mathematik- oder Prüfungsangst – sowie in auffälligem oder zurückgezogenem Verhalten. (vgl. Fischbach et al., 2010; Visser et al., 2019).
Ohne frühzeitige Förderung können sich die Begleiterscheinungen der Rechenschwäche auch im Erwachsenenalter fortsetzen. Studien weisen darauf hin, dass Rechenschwierigkeiten mit einem erhöhten Risiko für depressive Symptome verbunden sein können und darüber hinaus langfristige Auswirkungen auf das Berufsleben und die sozialen Perspektiven haben können. Betroffene haben tendenziell schlechtere Beschäftigungsaussichten und geringere sozioökonomische Chancen. (vgl. Kuhn, 2017, Visser und Kollegen, 2019)
Diese Erkenntnisse machen deutlich: Eine Rechenschwäche betrifft weit mehr als nur das Fach Mathematik. Sie kann das emotionale Wohlbefinden und die Lebensperspektive eines Kindes oder Erwachsenen nachhaltig beeinflussen und sollte deshalb immer ganzheitlich betrachtet und möglichst frühzeitig begleitet werden.

Impuls-Gespräch
Stelle mir in einem individuellen Beratungsgespräch alle deine Fragen rund um das Lernen mit LRS und Rechenschwäche.
Woran erkennt man eine Rechenschwäche / Dyskalkulie?
Die ersten Anzeichen einer Rechenschwäche zeigen sich oft schon beim Aufbau der grundlegenden mathematischen Fähigkeiten im vorschulischen Bereich – also lange bevor komplizierte Rechenoperationen auf dem Stundenplan stehen.
Symptome und Anzeichen einer Rechenschwäche
Erste Anzeichen zeigen sich bereits vor Schulbeginn: Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Erfassen von Mengen (z.B. den Punkten auf einem Würfel), dem Zählen oder dem Verstehen von Zahlenbeziehungen (5 ist eins mehr als 4) haben, entwickeln meist auch Probleme beim späteren Rechnenlernen. Oft werden diese Schwierigkeiten jedoch erst mit dem Schuleintritt sichtbar.
Fachlich gilt: Es gibt kein einheitliches Erscheinungsbild einer Rechenschwäche. Dennoch zeigen sich bestimmte typische Muster in der Entwicklung mathematischer Basiskompetenzen und der Grundrechenarten. So fällt es betroffenen Kindern häufig schwer,
- Zahlwörter in der richtigen Reihenfolge zu bilden (was kommt nach 69),
- Mengen Zahlen zuzuordnen (wie viele Steine sind das),
- Ziffern zu erkennen und sicher zu schreiben (52 oder 25) oder
- Rechenoperationen (z. B. Plus und Minus) gedanklich nachzuvollziehen (was bedeutet es, etwas wegzunehmen).
Eine Auflistung weiterer Symptome findest du hier: Woran kann ich Schwierigkeiten beim Rechnenlernen erkennen?
Diese Schwierigkeiten betreffen also nicht nur das Rechnen an sich, sondern schon das grundlegende Verständnis von Zahlen und Mengen. Im Unterricht zeigt sich das häufig daran, dass Kinder lange zählend rechnen oder gelernte Rechenwege stur wiederholen, ohne deren Sinn zu verstehen. Mit zunehmender Schulzeit verstärken sich die Rückstände, da auf unsicheren Grundlagen keine stabilen Rechenkompetenzen aufgebaut werden können.
Sekundäre Symptome: Wenn das Selbstvertrauen leidet
Neben Symptomen im mathematischen Bereich können bei Schülern mit einer Rechenschwäche auch sekundäre Symptome auftreten, z.B. kann eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung beobachtet werden. Aufgrund zahlreicher Misserfolgserwartungen schätzen die Schülerinnen und Schüler die Wahrscheinlichkeit ihres Erfolgs gering ein (Das werde ich sowieso nicht schaffen.). Die Selbstwirksamkeitserwartung sinkt – das heißt: Kinder glauben nicht mehr daran, Mathe verstehen zu können. Daraus ergibt sich eine gewisse Hoffnungslosigkeit und die Motivation, sich mit den mathematischen Inhalten auseinanderzusetzen, sinkt deutlich.
Das führt oft zu:
- geringem Selbstwertgefühl,
- Frustration und Vermeidungsverhalten,
- wachsender Angst vor Mathe oder Tests.
Schüler, die zu mir in die Lerntherapie kommen, befinden sich häufig an genau diesem Punkt: Sie sind sich sicher, dass sie Mathe „einfach nicht können“ oder „zu dumm“ dazu sind.
Forschungen zeigen, dass frühe negative Erfahrungen (Ich komme in Mathe nicht mit.) und wiederholte negative Rückmeldungen von Eltern oder Lehrkräften (Du hast schon wieder nicht genug geübt.) das mathematische Selbstkonzept und damit die Selberwirksamkeitserwartung (Ich schaffe das sowieso nicht!) nachhaltig beeinflussen können. Lassen wir es also gar nicht erst so weit kommen! (vgl. Moser Opitz, 2013)
Körperliche Reaktionen und Stresssymptome
Kinder mit einer Rechenschwäche zeigen häufig auch körperliche Beschwerden ohne erkennbare medizinische Ursache (ca. ein Fünftel der untersuchten Schüler). Dazu gehören etwa Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder allgemeines Unwohlsein, insbesondere vor Mathematikstunden oder Tests. Die Gruppe der älteren Schülerinnen und Schüler weist dabei eine stärkere Belastung auf als die Gruppe der jüngeren bis einschließlich der 5. Klasse. Wieder ein Zeichen dafür, eine Lerntherapie möglichst frühzeitig zu beginnen. (vgl. Huck & Schröder, 2016)
Warum frühes Erkennen einer Rechenschwäche so wichtig ist
Je länger die Schwierigkeiten bestehen, desto größer werden die fachlichen Lücken. Kinder mit Rechenschwäche können so dem Unterricht oft nicht mehr folgen, verlieren die Motivation und erleben Mathe als dauerhafte Überforderung. Hinzu kommen weitere Symptome wie ein geringes Selbstwertgefühl, Frustration und Vermeidungsverhalten und möglicherweise die Entwicklung von Ängsten, die sich auch in körperlichen Symptomen äußern können. Umso entscheidender ist es, frühzeitig zu handeln, erste Anzeichen ernst zu nehmen und mit gezielter Förderung gegenzusteuern.
Welche Ursachen kann eine Rechenschwäche / Dyskalkulie haben?
Die Entwicklung eines Kindes ist ein Zusammenspiel vieler Einflüsse – körperlicher, psychischer und sozialer. Das sogenannte biopsychosoziale Modell erklärt, dass biologische Faktoren (wie genetische Anlagen oder die körperliche Gesundheit), psychologische Faktoren (z. B. Emotionen, Denk- und Bewältigungsmuster) sowie soziale Umstände (Familie, Schule, Umfeld) gemeinsam auf die Entwicklung wirken. Kein Kind startet also mit denselben Voraussetzungen in die Schule – und genau das kann erklären, warum manche Kinder größere Schwierigkeiten im mathematischen Lernen zeigen als andere.
Kindbezogene Risikofaktoren
Zu den kindbezogenen Faktoren zählen sowohl angeborene als auch entwicklungsbedingte Merkmale. Ein wichtiger Punkt ist die genetische Veranlagung: Wenn bereits Geschwister oder Eltern eine Lernstörung haben, ist das Risiko für eine Rechenschwäche deutlich erhöht – laut Studien sogar um das Acht- bis Zehnfache. (vgl. Hasselhorn, 2022)
Darüber hinaus spielen kognitive Fähigkeiten wie das Arbeitsgedächtnis eine entscheidende Rolle. Dieses „Kurzzeit-Gedächtnis“ hilft, Informationen festzuhalten und zu verarbeiten. Ist seine Kapazität eingeschränkt, fällt es schwer, Rechenschritte im Kopf zu behalten oder neue mathematische Zusammenhänge zu verstehen. Besonders betroffen ist oft der visuell-räumliche Bereich, also das innere Vorstellen und Ordnen von Zahlen und Mengen. Kinder mit schwachem Arbeitsgedächtnis machen häufiger Zählfehler und haben Mühe, Rechenfakten langfristig zu speichern.
Viele meiner Schüler mit einer diagnostizierten Rechenschwäche haben auch Defizite im Bereich des Arbeitsgedächtnisses.
Auch die exekutive Funktionen – also die Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu steuern und unwichtige Informationen auszublenden – sind bedeutsam. Ist die sogenannte Inhibition geschwächt, fällt es schwer, sich beim Rechnen auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Ein weiterer Einflussfaktor ist die Sprachentwicklung. Zahlverständnis ist eng mit Sprache verknüpft, denn wer Zahlwörter oder mathematische Begriffe nicht sicher kennt, kann auch Rechenaufgaben schlechter verstehen. Untersuchungen zeigen, dass ein gut entwickelter Wortschatz im Kindergartenalter messbar mit besseren Rechenleistungen in der Grundschule zusammenhängt.
All diese Faktoren greifen ineinander: Kinder, die mit geringeren sprachlichen und kognitiven Voraussetzungen in die Schule starten, haben es beim Aufbau mathematischer Basiskompetenzen schwerer und entwickeln dadurch leichter eine Rechenschwäche.
Umweltbezogene Risikofaktoren
Neben den individuellen Voraussetzungen spielt auch das Umfeld eine große Rolle. Je anregender die Umgebung für Kinder ist, desto besser können sich mathematische Vorläuferfertigkeiten entwickeln. Studien zeigen z.B., dass einfache Dinge wie Brettspiele oder gemeinsame Zahlenspiele schon früh das Zahlenverständnis und die Orientierung auf dem Zahlenstrahl verbessern können (vgl. Siegler & Ramani, 2009). Was passiert, wenn du mit deinem Kind keine Gesellschaftsspiele spielst, habe ich hier beschrieben.
Auch die Qualität der schulischen Förderung ist entscheidend. Wenn Kinder mit unzureichenden Grundlagen in die Schule kommen, kann ein Unterricht, der zu schnell voranschreitet oder wenig individuell angepasst ist, die Probleme weiter verstärken. Lehrmethoden, eingesetzte Materialien und die sprachliche Gestaltung des Unterrichts haben daher großen Einfluss darauf, ob sich eine Rechenschwäche verfestigt oder abgemildert wird. Wenn du wissen willst, ob dein Mathebuch geeignet ist, einer Rechenschwäche vorzubeugen, dann schau mal hier: Rechenschwäche vermeiden: Wie ein gutes Mathe-Lehrwerk hilft.
Zusammenspiel von Anlage und Umwelt
Wie stark die einzelnen Risikofaktoren ins Gewicht fallen und wie viele zusammentreffen müssen, um eine Rechenschwäche auszulösen, ist wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Sicher ist aber: Biologische Voraussetzungen und Umwelteinflüsse wirken zusammen. Während genetische und kognitive Faktoren schwer veränderbar sind, können Umweltfaktoren – etwa familiäre Unterstützung oder gezielte schulische Förderung – entscheidend dazu beitragen, Risiken zu verringern.
Eine zentrale Erkenntnis lautet daher: Risikofaktoren werden erst dann zur Ursache einer Rechenstörung, wenn kein schulischer oder häuslicher Ausgleich erfolgt.
Das bedeutet, Kinder mit ungünstigen Startbedingungen brauchen nicht nur Verständnis, sondern auch frühzeitige und gezielte Unterstützung – in Familie, Kindergarten und Schule. Nur so lässt sich verhindern, dass aus anfänglichen Schwierigkeiten eine dauerhafte Rechenschwäche entsteht.
Ab wann und wie wird Rechenschwäche / Dyskalkulie diagnostiziert?
Der richtige Zeitpunkt für eine Diagnose
Erste Schwierigkeiten, wie das Zählen oder die Erfassung von Mengen, können bereits vor Schuleintritt beobachtet werden. Spätestens im ersten Halbjahr der ersten Klasse sollten Symptome in diesem Bereich erkannt und abgeklärt werden.
Der Mythos „Lernstörungen wachsen sich aus“ ist jedoch weit verbreitet. Viele Eltern handeln daher erst, wenn bereits massive Schwierigkeiten aufgetreten sind. In der Folge bekommen betroffene Schülerinnen und Schüler erst spät die notwendige Unterstützung und viel wertvolle Zeit und Möglichkeiten der Entwicklung gehen verloren. Frühe Unterstützungsmaßnahmen dagegen können belastende Folgen abmildern bzw. der Entwicklung einer Rechenschwäche vorbeugen.
Wer diagnostiziert eine Rechenschwäche?
Für die Diagnostik einer Rechenschwäche sind die Kinder- und Jugendpsychologen zuständig. Diese sind jedoch zunehmend überlastet, so dass Wartezeiten auf einen Termin häufig 6 bis 12 Monate betragen können. Viele Schulen wie auch viele Kinder- und Jugendpsychologen schicken Kinder daher erst ab Ende der 2. Klasse zur Testung. In manchen Bundesländern gibt es auch Schulpsychologen, die ebenfalls eine Rechenschwäche diagnostizieren können.
Ist die Erstellung einer ärztlichen Diagnose keine Voraussetzung (diese ist z.B. nötig bei der Beantragung staatlicher Hilfen), können Lerntherapeutinnen in einer pädagogischen Diagnostik den Lernstand des Kindes erfassen und daraus unterstützende Fördermaßnahmen ableiten. Was die Unterschiede zwischen der pädagogischen und medizinischen Diagnostik sind, kannst du hier weiterlesen.
Im Rahmen einer pädagogischen Diagnostik führe ich in der Regel eine Dyskalkuliediagnostik mithilfe eines standardisierten Tests durch (BADYS bzw. MBK1+, je nach Alter). Zusätzlich erhebe ich mit einem Fragebogen oder in einem Elterngespräch die bisherige Entwicklung des Kindes: Gab es Auffälligkeiten im vorschulischen Bereich, wann wurde das Hör- und Sehvermögen letztmalig untersucht usw. Diese zusätzlichen Informationen helfen mir dabei, die Testergebnisse besser einordnen zu können. Die Ergebnisse werte ich anschließend im Vergleich zur Altersgruppe aus und kann so aufzeigen, in welchen Bereichen Förderbedarf besteht. Ich stelle aber keine Diagnose „Dyskalkulie“. Für die meisten Eltern reicht dies jedoch völlig aus, denn entscheidend ist, dass das Kind frühzeitig Unterstützung bekommt.
Falls du Interesse an einer pädagogischen Diagnostik hast, kannst du hier weiterlesen:
Welche Hilfen gibt es bei einer Rechenschwäche / Dyskalkulie?
Eine Rechenschwäche betrifft immer grundlegende mathematische Fähigkeiten (Basiskompetenzen). Diese müssen zunächst aufgearbeitet werden, bevor schulisches Wissen darauf aufbauen kann. Eine Lerntherapie ist daher ein wichtiger Baustein bei der Behandlung einer Rechenschwäche. Wann eine Lerntherapie sinnvoll ist, habe ich in diesem Beitrag beschrieben.
Lerntherapie
Die integrative Lerntherapie setzt pädagogische und psychologische Methoden ein und arbeitet so neben den fachlichen Inhalten mit den Kindern und Jugendlichen auch an der Stärkung ihres Selbstwertgefühls und dem Umgang mit Schwierigkeiten. Neben der Arbeit mit dem Schüler spielen auch die Aufklärung der Lehrkräfte und Einbeziehung der Eltern eine entscheidende Rolle. Lerntherapie unterscheidet sich damit deutlich von Nachhilfe. Im Gegensatz zu klassischer Nachhilfe geht es hier nicht um das Pauken von Schulstoff, sondern um das Verstehen mathematischer Grundlagen und das Überwinden von Blockaden.
Wie eine Lerntherapie abläuft – von der Diagnostik bis hin zur Beendigung der Lerntherapie – findest du in diesem Beitrag.
Was macht eine gute Lerntherapie aus?
- Individuelle Diagnostik: Zuerst wird geprüft, wo genau die Schwierigkeiten liegen (z. B. Mengenverständnis, Zehnerübergang).
- Förderplan: Aufgrund der festgestellten Schwierigkeiten wird ein Förderplan erstellt, der dazu führt, dass fehlende Grundlagen Schritt für Schritt aufgebaut werden können
- evidenzbasiert: Die verwendeten Materialien sollten nachgewiesen wirksam sein, um die vorhandenen Schwierigkeiten auflösen zu können
- Ressourcenorientierung: Statt nur an den Schwächen zu arbeiten, sollten gezielt die Stärken des Kindes oder Jugendlichen in den Fokus gerückt werden
- Spielerische Elemente: Lernen soll Spaß machen, z. B. durch Würfelspiele, Rechenrätsel oder Bewegungsaufgaben.
- Elternarbeit: Lerntherapeutinnen geben Tipps, wie Eltern zu Hause unterstützen können (ohne Druck auszuüben!).
- Zusammenarbeit mit Lehrkräften: Lerntherapeutinnen beraten Lehrkräfte, wie sie Schüler optimal in ihrem Unterricht unterstützen können.
- Langfristige Begleitung: Rechenschwäche lässt sich nicht in wenigen Wochen „heilen“, aber mit Geduld und Kontinuität gibt es deutliche Fortschritte.
schulische Unterstützung
Schulen haben verschiedene Möglichkeiten, Kinder mit Rechenschwäche zu unterstützen. Allerdings hängt das Angebot oft von den Ressourcen und der Sensibilität der Lehrkräfte ab.
Matheunterricht
Gute Lehrkräfte setzen im Matheunterricht auf Differenzierung und bieten verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten an. So helfen vielen Schülern mit Rechenschwäche z.B. angepasste Aufgabenstellungen (nur 5 statt 10 Aufgaben lösen zu müssen) und die Verwendung von Anschauungsmaterial (unabhängig von der Klassenstufe). Auch gute Lehrwerke, die Kinder da abholen, wo sie stehen, tragen dazu bei, dass eine Rechenschwäche möglicherweise gar nicht erst entsteht. Ob dein Lehrwerk geeignet ist, kannst du mit meiner kostenlosen Checkliste überprüfen.
Förderunterricht
Darüber hinaus bieten die meisten Schulen Förderunterricht in Kleingruppen an. Diese werden jedoch nicht immer von in diesem Bereich fachlich geschultem Personal betreut. Häufig greifen die Fördergruppen die in der Klasse behandelten Inhalte auf und gehen daher an den Bedürfnissen der Schüler mit Rechenschwäche vorbei. Auch wenn es sich explizit um eine Fördergruppe für Rechenschwäche handelt, sitzen dort häufig 5-10 Kinder, die selten die gleichen Schwierigkeiten haben. Das Arbeiten an den individuellen Fehlerschwerpunkten ist daher nur bedingt möglich. Manche Schulen kooperieren mit externen Fachkräften und stellen ausgebildete Lerntherapeutinnen für die Förderung ein. Das ist jedoch leider noch viel zu selten der Fall. Eine Sammlung positiver Beispiele findest du bei meiner Kollegin Susanne Seyfried: So gelingt individuelle Förderung: 30+ Beispiele von Lerntherapie in Schule.
Nachteilsausgleich
Eine wichtige schulische Unterstützungsmaßnahme ist die Gewährung eines Nachteilsausgleichs. Schüler mit Rechenschwäche erhalten z. B. mehr Zeit bei Klassenarbeiten, angepasste Hausaufgaben, dürfen Kopfrechenaufgaben auch schriftlich lösen oder früher einen Taschenrechner verwenden. Ob ein Nachteilsausgleich bei Rechenschwäche gewährt wird und wie das Antragsverfahren geregelt ist, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Die Regelungen in Niedersachsen habe ich in folgendem Artikel zusammengefasst: Nachteilsausgleich bei LRS und Rechenschwäche – Was gilt in Niedersachsen? Darin findest du auch zahlreiche Verlinkungen zu den Regelungen in anderen Bundesländern.
Wie du dich als Elternteil auf das Gespräch mit der Lehrkraft vorbereiten kannst und was du bezüglich des Nachteilsausgleichs alles beachten solltest, findest du in SpeakUp – Nachteilsausgleich verstehen, ansprechen, gemeinsam umsetzen.

Wie können Eltern ihr Kind im Alltag unterstützen?
Wie oben bereits beschrieben, trägt auch die Gestaltung der Umwelt mit dazu bei, ob ein Kind eine Rechenschwäche entwickelt oder nicht. Schon vor Schuleintritt können Eltern mathematische Fähigkeiten spielerisch im Alltag fördern. Ideen dazu findest du in meinen Artikel Lernförderung ohne Druck: Lernchancen im Alltag entdecken.
Auch das Spielen von Gesellschaftsspielen trägt wesentlich zur mathematischen Entwicklung bei. Würfelspiele fördern das Erkennen von Mengen, das sichere Zählen und manchmal auch das spielerische Rechnen (z.B. beim Zusammenrechnen der erreichten Punkte).
Neben der mathematischen Entwicklung haben Eltern einen entscheidenden Einfluss darauf, wie Kinder mit Fehlern umgehen. Werden Fehler als Entwicklungshilfe gesehen oder negativ bewertet? Die Förderung eines Growth Mindsets trägt wesentlich zur Entwicklung eines positiven Lernverhaltens bei.
Wenn du wissen möchtest, wie du dein Kind in der Lerntherapie unterstützen willst, kannst du hier weiterlesen: Kinder in der Lerntherapie unterstützen – 33 Tipps für Eltern.
Fazit: Rechenschwäche ist kein Schicksal!
Dieser Artikel hat gezeigt: Rechenschwäche ist eine Herausforderung, aber kein unüberwindbares Hindernis. Mit der richtigen Mischung aus Fachwissen, Geduld und Zuversicht wird dein Kind nicht nur in Mathe besser – es wird auch stolz auf sich sein und lernen, dass es jede Hürde überwinden kann. Hoffnung ist stärker als Angst und dein Kind hat alle Chancen, seinen Weg zu finden!
Wenn du als Elternteil unsicher bist, wie du dein Kind am besten unterstützen kannst, dann zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine Lerntherapie kann gezielt mit deinem Kind an seinen Schwächen arbeiten und gleichzeitig die Stärken deines Kindes stärken. Ich begleite seit vielen Jahren Kinder mit Rechenschwäche und eines ist sicher: Mit der richtigen Methode und einer Portion Geduld lässt sich fast jedes „Mathe-Chaos“ entwirren!
Das könnte dein nächster Schritt sein:
- Kontaktiere mich für ein Impulsgespräch – hier kannst du alle deine Fragen stellen und wir suchen gemeinsam nach Lösungen.
- Stöber weiter auf meinem Blog nach weiteren Tipps und Übungen.
- Abonniere meinen Newsletter, wenn du mehr von mir hören und zu den ersten gehören willst, die ich über freie Plätze in der Lerntherapie informiere.