Hast du Würfel zu Hause? Dann hast du bereits eines der besten Werkzeuge, um dein Kind beim Rechnenlernen zu unterstützen. In der Lerntherapie begegnen mir aber immer wieder Kinder, die meine Frage nach den Würfeln verneinen. Diese Kinder haben nicht nur keine Würfel zuhause, sondern auch keine Gesellschaftsspiele, bei denen gewürfelt wird. Sie spielen demnach vermutlich auch kaum gemeinsam mit der Familie. Gleichzeitig werde ich aber oft von Eltern gefragt, mit welchen Fördermaterialien sie ihr Kind unterstützen können, wenn es in Mathe Schwierigkeiten hat. Meine Antwort ist dann ganz klar: Es braucht keine Apps oder Förderhefte, sondern einfach nur Spiele. Klassische Gesellschaftsspiele, Karten oder Würfel. Mehr nicht.
Du denkst, Gesellschaftsspiele sind nur Spielerei? In diesem Artikel zeige ich dir, dass sie ganz entscheidend dazu beitragen, das Rechnenlernen zu unterstützen.
1. Ohne Spielpraxis fehlen Zahlgefühl und Mengenverständnis
Wie viele Runden UNO ich in meinem Leben schon gespielt habe, kann ich nicht mehr zählen. Erst kürzlich haben die Kinder von Freunden das Spiel für sich entdeckt, und natürlich haben wir alle gemeinsam ein paar Runden gespielt. Mein liebstes Spiel ist aber Kniffel. Heute frage ich mich, ob das auch so wäre, hätte mir früher jemand gesagt: „Komm, lass uns ein bisschen Kopfrechnen üben!“ – auch, wenn wir genau das gemacht haben.
Spiele wie UNO oder einfache Würfelspiele helfen Kindern, Zahlen zu sehen, zu erkennen und zu verinnerlichen. Sie lernen die Zahlbilder von 0 bis 9, das Erfassen von Mengen durch Würfelpunkte und das Abzählen von Feldern. Das Zählen automatisiert sich durch ständiges Wiederholen. Zuerst wird noch mit den Fingern nachgeholfen, später zählen Kinder im Kopf weiter. Diese körperlich eingebetteten Rechenhandlungen (z. B. das Antippen der Felder) helfen, die Abläufe im Gehirn zu verankern. Erst wenn das Zählen automatisiert ist, wird im Arbeitsgedächtnis Platz für das eigentliche Rechnen frei.
Natürlich werden das Aussehen der Zahlen bis 10 und die Würfelbilder (meist bis 6) in den ersten Stunden des Mathematikunterrichts der ersten Klasse thematisiert. Klar ist aber auch, dass der Schulerfolg in Mathematik in der ersten Klasse vom vorschulisch erworbenen Wissen in den sogenannten Basisfertigkeiten abhängt. Also genau die Zahlwortreihe bis 10, dem Abzählen, dem ganzheitlichen Erkennen von Punktemengen auf einen Blick und der Entscheidung über „mehr“ oder „weniger“ beim Vergleich zweier Mengen.
2. Ohne Spielerfahrung bleibt Rechnen abstrakt
Kinder müssen erleben, was „mehr“ oder „weniger“ bedeutet. Wenn ich bei UNO meine ganze Hand voll Karten habe, kann ich einfach erkennen, dass mein Mitspieler weniger Karten auf der Hand hat, weil er sie ohne Probleme halten kann. Solche Erlebnisse machen Mengenunterschiede greifbar. Ohne sie bleibt „mehr“ nur ein abstrakter Begriff.
Auch Plus- und Minusbeziehungen sind in vielen Spielen ganz selbstverständlich eingebettet: „Ich brauche noch 5 Felder bis ins Ziel“ oder „Wenn ich eine 2 würfle, kann ich dich rausschmeißen“ – solche Überlegungen sind einfache Additionen und Subtraktionen im Kopf. Kinder trainieren dabei ganz nebenbei, wie sich Zahlen zueinander verhalten, welche Zahl zur nächsten fehlt und was beim Addieren oder Subtrahieren passiert.
Wer solche Erfahrungen nicht macht, muss sich Rechenbeziehungen mühsam im Unterricht erarbeiten. Statt über konkrete Spielsituationen ein Gefühl für Zahlen zu entwickeln, bleibt das Rechnen abstrakt und wird schnell zum rein schulischen Wissen.
Du willst wissen, ob dein Erstklasslehrwerk geeignet ist, um Schüler mit fehlendem Vorwissen abzuholen? Dann lies mal in meinem Artikel Mathematiklehrwerk – Hilfe oder Hürde im Lernprozess? weiter.
3. Ohne Spielraum fehlt Frustrationstoleranz und strategisches Denken
Gesellschaftsspiele trainieren weit mehr als Zahlen: Sie fördern emotionale und kognitive Kompetenzen. Wer regelmäßig spielt, lernt: Ich kann nicht immer gewinnen. Beim gemeinsamen Spielen muss ich abwarten, bis ich an der Reihe bin. Kinder üben beim Spielen ganz nebenbei, mit Frust umzugehen – etwa wenn sie kurz vorm Ziel rausgeworfen werden – für mich immer nur schwer auszuhalten – oder eine dringend benötigte Karte nicht kommt. Sie erleben Rückschläge in einem sicheren Rahmen und lernen: Das gehört dazu. Ich darf mich ärgern, aber ich mache trotzdem weiter.
Auch strategisches Denken wird geschult. Welchen Spielzug mache ich? Welche Karte behalte ich zurück? Wann gehe ich auf Risiko? All das fördert die Fähigkeit, vorausschauend zu planen und das ist eine wichtige Grundlage für das Problemlösen im Schulalltag.
Und noch etwas lernen Kinder beim Spielen: Nicht alles ist planbar. Manchmal entscheidet der Zufall. Ich erinnere mich an eine Schülerin, die davon überzeugt war, dass ihr Würfel kaputt sei, weil sie dreimal hintereinander eine 3 gewürfelt hatte. Wir haben dann ein paar Runden „Testwürfeln“ gemacht und siehe da: Später kam keine einzige 3 mehr. Auch solche Gespräche über Wahrscheinlichkeit und Zufall schulen das mathematische Denken und dazu, Dinge zu hinterfragen.
4. Ohne Zahlenbrille bleibt Mathe nur Schulstoff
Rechnen ist überall. Beim Besteckzählen, beim Würfeln, beim Überlegen, ob die Tapete reicht (kleiner Spoiler: Ich habe immer zu viele Rollen auf Vorrat). Wer in seiner Kindheit nie gelernt hat, Zahlen in der Alltagswelt zu erkennen, erlebt Mathematik nur als „Schulsache“, als trocken, schwer und etwas Abstraktes.
Ideen, wie du Lernchancen im Alltag entdecken kannst findest du in meinem Artikel Lernförderung ohne Druck. Dort findest du auch den Link zu meinem 0 €-Angebot 50 Alltagsideen, um das Lesen, Schreiben und Rechnen zu fördern.

Kinder, die regelmäßig spielen, entwickeln dagegen einen Blick für Zahlen in ihrer Umgebung. Sie verstehen z. B., dass Hausnummern meist einem bestimmten System folgen oder dass eine 4 beim Würfeln nicht nur eine Zahl, sondern ein konkreter Fortschritt im Spiel ist. Gerade bei meinen Schülern mit Rechenschwäche (Dyskalkulie) sind Würfelspiele sehr beliebt. Sie bieten einen niedrigschwelligen Einstieg in das mathematische Denken, was ihnen sonst so schwerfällt. Rechnen wird so mit Spaß und Spielfreude verbunden. Bezeichnend finde ich es, wenn sich meine Schüler bei freier Wahl aus allen Spielen im Regal – und das sind wirklich sehr viele – genau das eine Lernspiel aussuchen, bei dem sie in jedem Schritt rechnen müssen, weil ihnen das Spiel einfach so viel Spaß macht. Was gibt es besseres?
Mathematik hilft uns, unsere Welt zu verstehen und alltägliche Probleme zu lösen. Kinder, die nie mit Würfeln oder Zahlenkarten in Berührung kommen, erleben diese Verbindung nicht und verpassen so eine wichtige Brücke zwischen Schulstoff und Lebenswelt.
5. Ohne Mitsprechen fehlt mathematische Sprachpraxis
Ganz entscheidend beim Rechnenlernen ist das Sprechen über Zahlen und ihre Beziehungen zueinander. Beim gemeinsamen Spielen geschieht das ganz nebenbei: „Du brauchst eine 4!“ oder „Was fehlt noch bis 6?“ Dieses Sprechen in konkreten Spielsituationen unterstützt den Aufbau mathematischer Grundvorstellungen.
Wenn Erwachsene beim Spielen ihre Denkprozesse laut machen – „Ich habe eine 5 gewürfelt, also darf ich fünf Felder vor“ – dann wird Mathematik sichtbar. Kinder lernen so nicht nur das Rechnen selbst, sondern auch, über mathematische Sachverhalte zu sprechen. Das ist eine wichtige Grundlage für das Verstehen von Text- und Sachaufgaben.
6. Ohne gemeinsame Spiele fehlt Beziehung – und ein gutes Vorbild
Gesellschaftsspiele sind mehr als Zeitvertreib, sie sind gemeinsame Erlebnisse. Wer spielt, teilt Zeit, lacht miteinander, fiebert mit und erlebt kleine Höhen und Tiefen gemeinsam. Diese Momente schaffen Verbindung zwischen Eltern und Kindern, Geschwistern und Freunden.
Gleichzeitig machen Spiele Zahlen erlebbar. In Familien, in denen gewürfelt, gezählt und gerechnet wird, ist Mathematik etwas Alltägliches – etwas, das dazugehört und sogar Spaß machen kann.
Wir Erwachsene haben dabei eine wichtige Vorbildfunktion: Wenn wir selbst mit Freude mitspielen, zeigen wir, dass Mathe kein Angstfach ist, sondern ein Teil des Lebens, mit dem man spielerisch umgehen kann. Wer diese Chance ungenutzt lässt, verpasst nicht nur wertvolle Familienzeit, sondern auch die Möglichkeit, eine positive Haltung zur Mathematik vorzuleben, die Kinder prägt und ihr Lernen nachhaltig beeinflusst.
Mein Fazit:
Gesellschaftsspiele sind viel mehr als Spielerei. Sie sind ein Schatz für die mathematische Entwicklung deines Kindes. Zudem sind sie leicht zugänglich, alltagsnah und mit viel Spaß verbunden. Also: Würfel raus, Karten mischen und los geht’s!
Falls du Ideen für einfache Mathespiele suchst, schau gerne mal hier nach Mathe üben mit Spaß: 7 einfache Spiele für mehr Lernerfolg.
Wenn du Lust hast weiter zu lesen, findest du bei Angela Carstensen 7 Konsequenzen, die es hat, wenn wir nicht (mehr) lernen und was das mit Selbstbestimmung zu tun hat: Das passiert, wenn wir nicht lernen.



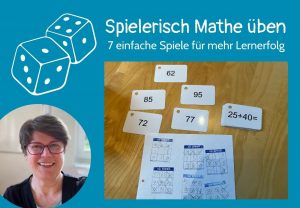


Pingback:Probleme mit Mathe – Was ich bei der Nachhilfe beobachte
Pingback:Das passiert, wenn wir nicht lernen – 7 Konsequenzen
Danke, danke, danke! Was für ein wichtiger Beitrag, gerade auch aus meiner Sicht als Nachhilfelehrerin für (größtenteils aus Nachfragegründen) Mathematik.
Wie oft ich im Unterricht sage: Das ganze Leben besteht aus Sachaufgaben. Und wie oft meine Schüler:innen im Oberstufenbereich davon profitieren könnten, als Kinder Stochastik mit einem Würfel trainiert zu haben.
Besonders bewegend finde ich die Punkte, dass wir als Erwachsene Vorbilder sind und dass spielerisches Lernen keine Spielerei ist, sondern ein sehr effektiver Zugang zum Gehirn.
Liebe Grüße
Angela
Hallo Angela,
aus dieser Perspektive habe ich es noch gar nicht betrachtet. Aber klar gilt das auch für ältere Schüler! Spielerisch können wir so viel lernen und so viel besser als mit Arbeitsblättern. Es könnte also so einfach sein 😉
Liebe Grüße
Sabine
Ich habe eine Habittracker-App, die mich dafür belohnt, wenn ich ToDos erledige. Dabei gibt es Eier für Tiere zu sammeln und Tränke, mit denen diese Eier dann zum Schlüpfen gebracht werden können. Es gibt neun Standardtiere und zehn Standardtränke. Und wer diesen Setzkasten mit 90 Standradkombinationen voll gesammelt hat, bekommt ein Abzeichen. Das ist dermaßen motivierend, ich habe keine Worte dafür.
Die letzten Wochen waren für mich ein Training in Binomialverteilung, weil diese Dinge per Zufallsgenerator droppen und ich schon richtig viele Eier und Tränke auf Vorrat hatte, die ich aktuel gar nicht mehr brauchte, während ich händeringend auf den letzten Zombietrank wartete. Ich war kurz davor, mir das auszurechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass bei XY gedroppten Gegenständen kein verdammter Zombietrank dabei ist 😉
😄 ich hoffe, du hast deinen Zombietrank mittlerweile bekommen! Das Thema Wahrscheinlichkeit hat für viele nur mit Schulmathematik zu tun, dabei ist es sehr alltäglich. Bei vielen Würfelspielen muss ich genau überlegen, ob ich nochmal würfle oder lieber die bisherige Augenzahl behalte. Also ein ganz einfaches Beispiel, um Kinder an das Thema Wahrscheinlichkeit heranzuführen. Und wie du in deinem Blogartikel schreibst: Je mehr ich lerne, desto weniger falle ich auf falsche Versprechungen herein. Schließlich kann ich mir die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Ereignis eintreten wird, dann selbst erklären 😉
Pingback:KW30/2025: Alle TCS-Blogartikel - The Content Society